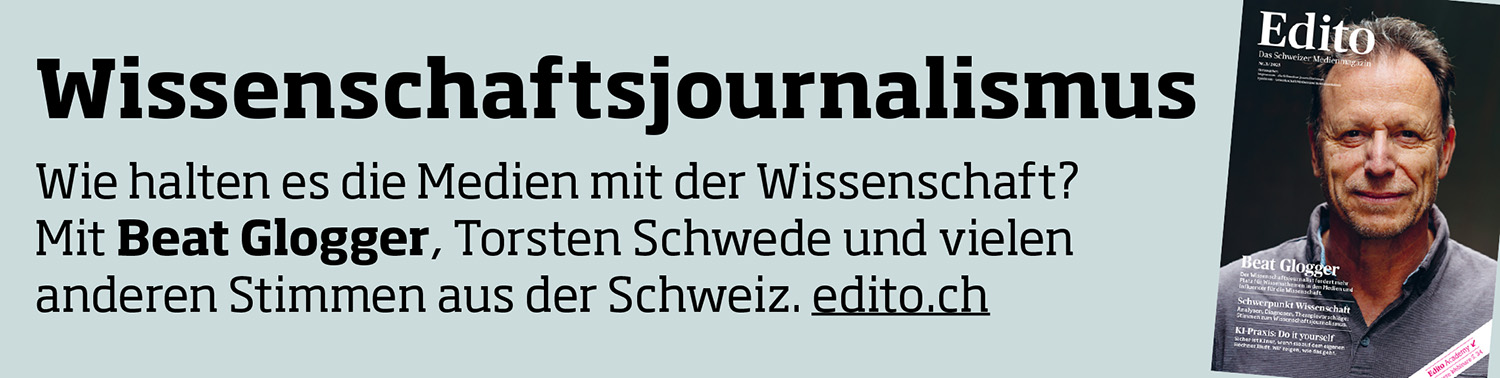Für Matthias Geering, Leiter Kommunikation der Universität Basel, spielen die Medien eine ähnliche Rolle wie der Peer-Review-Prozess in der Wissenschaft: Sie begleiten die Universitäten kritisch und können «die Auswirkungen von Forschung auf Wirtschaft und Gesellschaft einem breiten Publikum näherbringen». Deshalb seien die Universitäten froh über den Wissenschaftsjournalismus. Den Abbau der Leistungen sieht er kritisch. Die Universität Basel wappnet sich dagegen, indem sie eigene Kanäle aufbaut.
Welche Bedeutung haben die eigenen Kommunikationsleistungen für die Universität Basel?
Wir wollen mit unserer Kommunikation der breiten Gesellschaft aufzeigen, was wir mit den Ressourcen machen, die uns anvertraut worden sind. Wir wollen nachweisen, dass die Investitionen Forschung und Lehre einen Mehrwert für die der Gesellschaft generiert. Wir sind dankbar dafür, dass die Bevölkerung unserer Trägerkantone viel Geld in die Universität investiert. Die Kommunikation hat nicht zuletzt auch die Aufgabe, den Impact aufzuzeigen, den die Universität mit diesen Geldern erzielt.
Welche Rolle spielt das Magazin «Uninova»?
Wir haben nur noch eine gedruckte Publikation: Das ist «Uninova». Damit gehen wir in eine Tiefe, wie wir es mit digitalen Kommunikationsmitteln nicht erreichen können. Wir sind uns bewusst, dass wir damit vor allem eine Community ansprechen, die uns bereits kennt und uns schätzt. Aber die Leserinnen und Leser sind wichtige Botschafter für uns: Sie tragen unsere Anliegen in die Gesellschaft. Die Gruppe, welche Printprodukte liest, wird aber zusehends kleiner.
Wie wichtig sind digitale Kanäle?
Mit unseren digitalen Kanälen erreichen wir ein breites Publikum: Wir bespielen die sozialen Medien, betreiben Podcasts und produzieren Videos. Wir möchten den Menschen aber auch direkt begegnen. Deshalb sind wir zum Beispiel auf Märkten im Kanton Basel-Landschaft mit einem Stand präsent und zeigen dort unsere Forschung. Da begegnen wir Menschen, die wir sonst nie erreichen. Weiter haben wir Angebote wie die Wissensbox. Mit dieser Wissensbox gehen Doktorierende in die Primarschulen und erklären den Schulkindern Wissenschaft in einfachen Worten und Experimenten – zu Themen wie Mikroskopie oder Mathematik. Damit erreichen wir Kinder, die sonst nicht mit der Universität in Berührung kommen. An die Kinderuni kommen Kinder jener Eltern, die bereits hochschulaffin sind, mit der Wissensbox in der Primarschule erreichen wir alle Kinder und können ihre Neugier wecken, auch wenn sie von Haus aus keinen Bezug zur Akademie haben. Das Spektrum der Kommunikationsmittel ist heute also sehr breit, vom Digitalen über Print bis zum Event.
Welche Rolle spielt der Wissenschaftsjournalismus in den journalistischen Medien?
In der Wissenschaft spielt der sogenannte Peer-Review-Prozess eine grosse Rolle – die kritische Prüfung von Forschungsresultaten durch andere Forschende. Dieselbe Rolle spielen die jene Medien, welche unser Tun kritisch begleiten und die Auswirkungen von Forschung auf Wirtschaft und Gesellschaft einem breiten Publikum näherbringen können. Deshalb sind wir froh, dass es immer noch Medien gibt, die den Wissenschaftsjournalismus pflegen. Denn die Wissenschaftsjournalisten bringen einen unabhängigen Blick ein.
Werbung
Wie nimmst Du den Abbau der Wissensseiten wahr?
Das ist zu bedauern, ich kann es aber ökonomisch nachvollziehen. Unsere Reaktion darauf ist, dass wir vermehrt versuchen, mit eigenen Kanälen die Menschen zu erreichen. Wir haben auf LinkedIn knapp 85’000 Follower, da können wir Interessierte ansprechen. Wir müssen das aber mit journalistischem Anspruch tun und auch der eigenen Forschungsarbeit kritisch begegnen.
Wie wichtig ist SRF?
SRF ist eines der wenigen Medienhäuser, die Qualität liefern, für die man – über die Grundgebühr hinaus – nicht bezahlen muss. SRF bietet hohe Qualität ohne Kostenfolge. Das ist gesellschaftlich sehr wichtig, weil sich nicht alle Menschen ein Zeitungs- oder Online-Abo leisten können.
Wie erreicht die Uni Basel junge Menschen?
Instagram und TikTok sind die wichtigsten Kanäle. Wir haben dabei zwei verschiedene Aufgaben. Eine Aufgabe ist es, jene jungen Menschen anzusprechen, die bei uns studieren möchten. Eine ganz andere Aufgabe ist es, junge Menschen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu erreichen. Für Kinder haben wir dafür die Wissensbox und die Kinderuni. Bei Jugendlichen ist es schwierig, denn sie interessieren sich oft nicht für Wissenschaften. Da kommt man nur mit spielerischen Videoformaten weiter. Man könnte zum Beispiel mit Influencern arbeiten. Das scheitert aber an den dafür nötigen finanziellen Ressourcen. Immerhin sind unsere Videoformate, die sich an zukünftige Studierenden richten, nicht nur Studi-Marketing, sie zeigen auch, wie Wissenschaft im Alltag funktioniert.
Was ändert die KI?
Wir sehen noch keine belegbaren Auswirkungen bezüglich der Wahrnehmung der Universität. KI ist aber für unseren Betrieb eine grosse Herausforderung. Das wird Lehrpläne und Prüfungsmethoden komplett verändern. KI soll als Werkzeug eingesetzt werden. Deshalb sollen die Studierenden lernen, wie man die KI verantwortungsvoll einsetzen kann. Das zu vermitteln, gehört zum Auftrag der Uni. Wir haben deshalb eine KI-Initiative an der Uni Basel lanciert: Kompetenz im Umgang mit der KI wird zur zentralen Herausforderung – nicht nur für die Universitäten, sondern für die Gesellschaft als Ganzes.