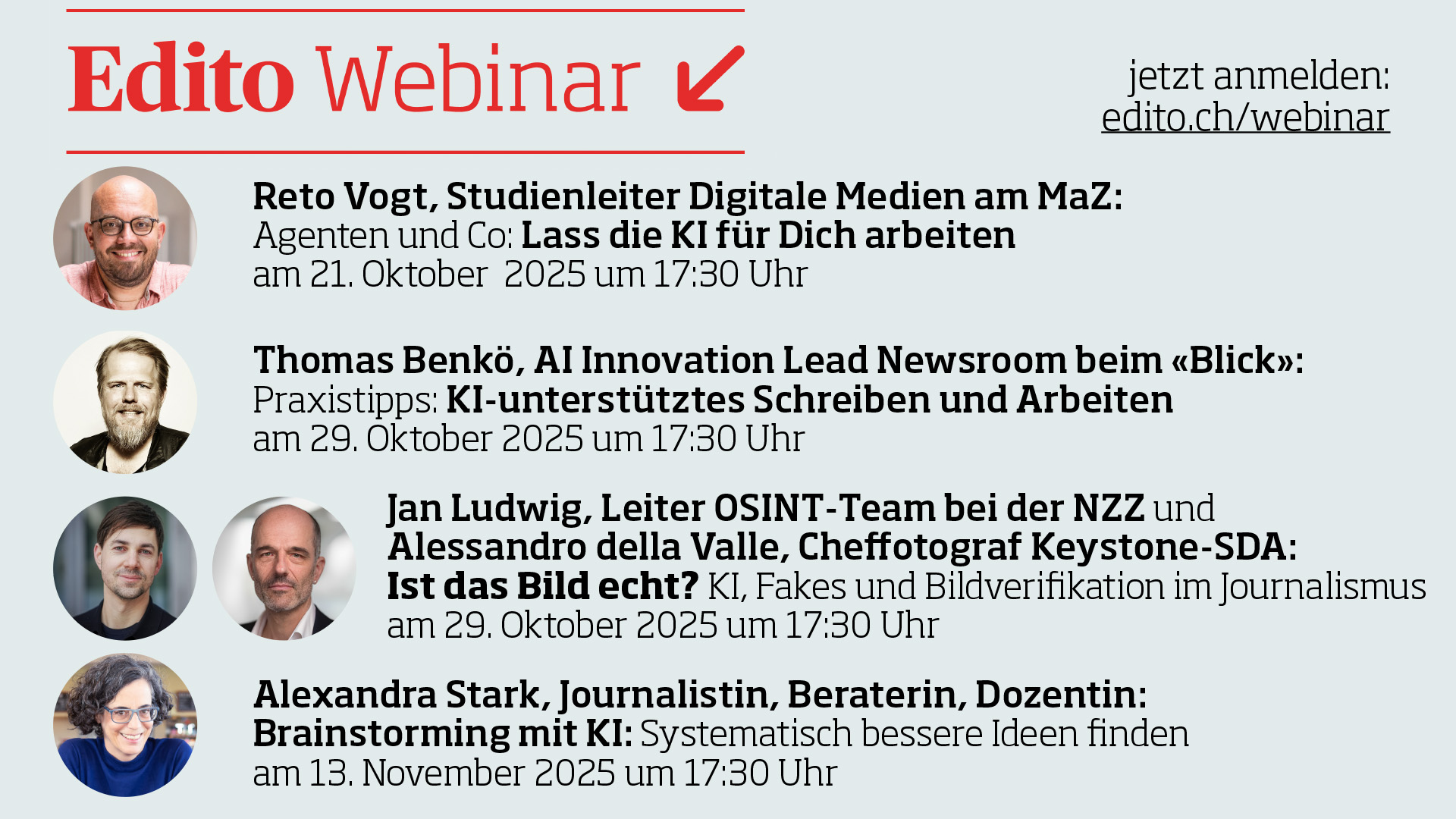Im Juni 2025 wurden das Büro und die Wohnung des Zürcher Finanzjournalisten Lukas Hässig durchsucht. Der Fall schlug hohe Wellen, sogar die «Financial Times» berichtete: «Finance blog raided over suspected Swiss banking secrecy law breaches». Was war da los?
Von Manuel Bertschi
Im Juni 2025 durchsuchte die Zürcher Staatsanwaltschaft Wohnung und Büro des Finanzjournalisten Lukas Hässig («Inside Paradeplatz»). Grund war der Verdacht, er habe 2016 mit Berichten über Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz gegen Artikel 47 Bankengesetz verstossen, der die Weitergabe von Bankkundendaten strikt verbietet. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte Hässigs Laptop, das Handy und verschiedene Dokumente. Es war der erste bekannte Fall, dass das Bankgeheimnis direkt gegen einen Journalisten angewendet wurde. Der Vorgang löste breite Kritik aus, weil er als Gefahr für Pressefreiheit und Quellenschutz gilt.
Seit der Revision im Jahr 2015 erfasst die Strafnorm zum Bankgeheimnis (Art. 47 BankG) nicht mehr ausschliesslich Bankangestellte, sondern auch Drittpersonen und damit auch Medienschaffende. Der Gesetzgeber hat es jedoch unterlassen, eine spezifische gesetzliche Grundlage zu schaffen, auf die sich Medienschaffende berufen können, wenn sie im öffentlichen Interesse Bankdaten veröffentlichen. Immerhin liess die damalige Justizministerin 2014 im Parlament anklingen, dass sich im Zusammenhang mit der journalistischen Verwendung solcher Daten strafrechtliche Rechtfertigungsgründe geltend machen liessen.
Auch wenn die Strafnorm zum Bankgeheimnis keine ausdrücklichen Ausnahmeregelungen für Medienschaffende enthält, können sich diese bei Finanzenthüllungen, die im öffentlichen Interesse liegen, auf strafrechtliche Rechtfertigungsgründe berufen. Dies zeigte sich eben gerade im Fall Hässig: Das eingangs erwähnte Zwangsmassnahmengericht erwog zugunsten von Hässig, dass er «konkret auf ein allfälliges Fehlverhalten seitens zweier Grossbanken» hingewiesen und damit «im Sinne der Gesellschaft gehandelt» habe.
Werbung
Obschon das Zwangsmassnahmengericht des Zürcher Bezirksgerichts in der Causa Hässig zugunsten der Medienfreiheit entschieden und die Entsiegelung abgelehnt hat, könnte bereits die Drohung einer Hausdurchsuchung eine einschüchternde Wirkung (chilling effect) entfalten.
Orientierung an «Suisse Secrets»
Bereits vor der Hausdurchsuchung bei Hässig schreckte die betreffende Strafnorm ab, wie sich exemplarisch an der internationalen «Suisse Secrets»-Recherche zeigte. Dabei wurden vertrauliche Kontodaten der Credit Suisse durch ein Netzwerk investigativer Journalistinnen und Journalisten geleakt. Diese Kontodaten offenbarten die Verbindungen zu mutmasslich korrupten oder autoritären Akteuren weltweit. Schweizer Medienschaffende beteiligten sich aus Furcht vor strafrechtlichen Konsequenzen im Zusammenhang mit dem Bankgeheimnis nicht an der Recherche.
Die Rechtsprechung zeigt, dass der journalistische Quellenschutz seitens der Strafgerichte nach wie vor sehr hoch gewichtet wird. Dies offenbarte sich zuletzt nicht nur in der Causa Hässig, sondern auch bei den sogenannten «Corona-Leaks».
Anders präsentiert sich die Lage in Zivilverfahren: Wenn Medien etwa potenziell persönlichkeitsverletzende Tatsachenbehauptungen verbreiten, tragen sie hierfür grundsätzlich den Wahrheitsbeweis. Dies kann dazu führen, dass Medien ihre Quellen offenlegen müssen, sofern sie zum Wahrheitsbeweis antreten.
Im Zusammenhang mit der «Suisse Secrets»-Recherche befasste sich die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats 2022 mit der Pressefreiheit im Finanzbereich. Obwohl zunächst kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf gesehen wurde, beauftragte die Kommissionsmehrheit später den Bundesrat mit einer Motion, um eine Gesetzesänderung zum besseren Schutz von Medienschaffenden zu prüfen. Der Bundesrat anerkannte den Stellenwert der verfassungsrechtlich garantierten Medienfreiheit und erklärte sich im Vorfeld bereit, die verlangte Prüfung vorzunehmen. Während der Nationalrat die entsprechende Motion annahm, lehnte sie der Ständerat ab. Die Hausdurchsuchung beim Journalisten Hässig dürfte jedoch erneut politische Vorstösse auslösen, die auf eine gesetzliche Präzisierung zum besseren Schutz von Medienschaffenden abzielen.
Manuel Bertschi ist Rechtsanwalt bei 4sight legal (Zürich) und Spezialist für Medien- und Urheberrecht.