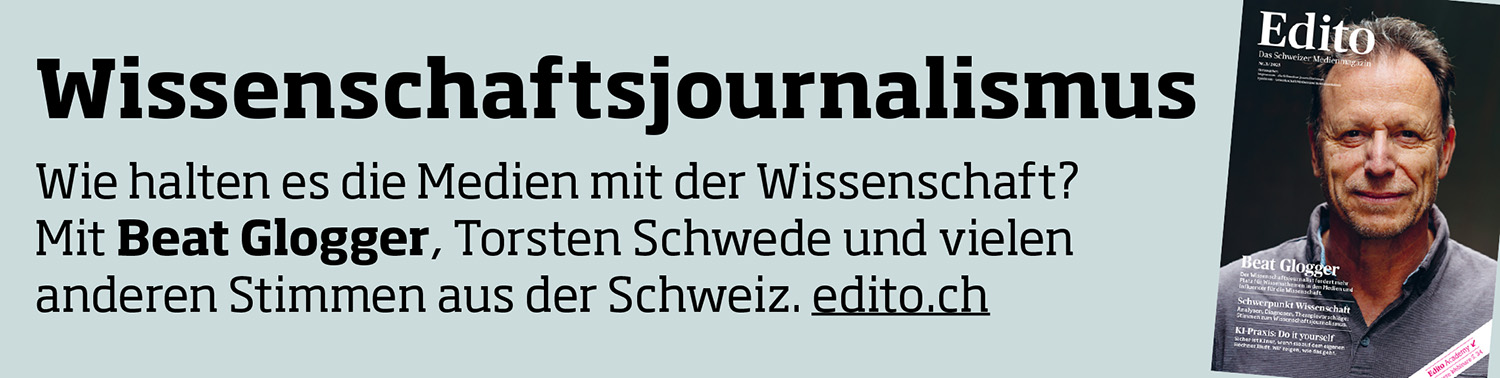Alexandra Stark arbeitet als KI-Expertin für CH Media und sieht eine neue Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine kommen. Wichtigste Voraussetzung für den kompetenten Umgang mit KI sei «eine gute Einführung und Anleitung» der Mitarbeitenden. Technologie bleibe dabei immer nur ein Mittel zum Zweck.
Du arbeitest als Expertin KI bei CH Media – was heisst das konkret?
Ich bin Teil des Teams KI-Transformation im Publishing, das ist der Teil von CH Media, der die Printtitel und zugehörigen Onlineportale produziert. Ich verstehe mich als Übersetzerin zwischen Journalismus und Technologie. Unser Team besteht aus drei Leuten mit total rund 150 Stellenprozenten für KI. Weil CH Media im Moment die IT-Systeme umstellt, sind unsere technischen Möglichkeiten derzeit stark eingeschränkt. Wir arbeiten deshalb mit verfügbaren Tools wie ChatGPT. Wir versuchen herauszufinden, wie wir die redaktionelle Arbeit mit KI unterstützen können. Zusammen mit Stefan Trachsel, der das Team leitet, verankern wir das Thema KI beispielsweise durch Schulungen in den Redaktionen.
Wie nehmen das die Redaktorinnen und Redaktoren auf?
Bei CH Media sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neugierig. Natürlich ist auch Skepsis dabei. Es kommen Fragen zu Risiken und Jobsicherheit, das ist ja auch richtig so. KI hat das Potenzial, tiefschürfende Veränderungen zu bringen, nicht nur im Journalismus. Das darf man nicht schönreden. Viele Kolleginnen und Kollegen sehen aber Chancen darin, dass sie Routinearbeiten an die Maschine delegieren und sich wieder mehr auf jene journalistischen Kernaufgaben konzentrieren können, bei denen man nur als Mensch einen Unterschied machen kann. Etwa indem man ein weiteres Gespräch führt, rausgeht oder einen anderen Dreh entwickelt.
Es heisst oft, dass ältere Mitarbeitende bremsen würden. Bei uns ist das nicht so. Grundsätzliche Vorbehalte melden eher die Jungen an. Ich erkläre mir das so: Erfahrene Journalistinnen und Journalisten können besser einschätzen, welche Aufgaben ihnen Tools abnehmen können. Sie können Probleme besser analysieren und genauer beschreiben. Die Erfahrenen unter uns können deshalb mehr herausholen.
Bei allen aber ist Voraussetzung für den kompetenten Umgang mit KI, dass sie eine gute Einführung und Anleitung erhalten. Das bieten wir mit unseren Schulungen und unseren Tools, die wir entwickeln. Mir macht es extrem viel Freude, dass ich meine 25 Jahre Erfahrung im digitalen Storytelling und als Trainerin voll einbringen kann.
Wo siehst Du die grossen Chancen beim KI-Einsatz auf einer Redaktion?
Wir sollten in einem ersten Schritt repetitive, monotone Aufgaben der Maschine überlassen. Darin sehen wir eine grosse Chance. Im Journalismus gibt es viele solcher Tätigkeiten: etwa Informationen aus E-Mails extrahieren und ins Planungstool eintragen oder Basisrecherchen durch schnelleren Zugriff aufs Archiv erledigen. KI kann heute schon bei der Suchmaschinenoptimierung helfen, Texte gegenlesen oder Verschlagwortungen übernehmen. Das sind alles wichtige, aber zeitaufwändige Aufgaben.
Werbung
In einem zweiten Schritt werden wir uns mit viel grundlegenderen Fragen beschäftigen müssen. Wie nutzen wir Personalisierung? Welche neuen Produkte können wir unseren Leserinnen und User dank KI anbieten? Unser Team heisst nicht zuletzt auch deshalb «KI-Transformation».
Wo liegen die Risiken?
Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber ich sehe für Medien vor allem Chancen: Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Internet schon bald komplett geflutet sein wird mit Inhalten, die wir nicht mehr glauben können. Wir haben jetzt die einmalige Chance, dass wir uns Medien als Anlaufstelle für vertrauenswürdige Informationen positionieren können. Das heisst aber auch, dass wir sehr vorsichtig und zurückhaltend sein müssen beim Einsatz von KI. Denn die Glaubwürdigkeit ist schnell weg. Deshalb haben wir auch Regeln entwickelt, wo es unter anderem heisst: Hinter jedem Inhalt steht ein Mensch, der ihn verantwortet und freigibt.
Was bedeutet das künftig für den Berufsalltag von Journalist:innen?
Es wird eine neue Arbeitsteilung geben zwischen Mensch und Maschine. Es müssen nicht alle Journalistinnen und Journalisten KI-Nerds werden. Aber kompetente und sichere Anwenderinnen und Anwender. Es ist deshalb zentral, dass alle mindestens verstehen, was KI ist und wie sie funktioniert. Nur dann können wir einschätzen, was wir von der Technik verlangen können, wo die Chancen sind und wo die Risiken. Alle müssen wissen, was ein Prompt ist und wie Prompting funktioniert, aber wir müssen nicht alle Promptengineers werden. Deshalb haben wir uns in einem ersten Schritt auf Schulung der Teams und der Menschen fokussiert. Als Menschen dürfen wir nie von der Technik getrieben sein, wir müssen am Steuer sitzen.
Wir schulen in kleinen Teams und Ressorts mit Beispielen aus dem Alltag der Teilnehmenden. Die Schulungen werden auf diese Weise auch zum Inkubator für neue Entwicklungen: Es entstehen Ideen und Prototypen, die wir mit dem Team, die das Thema aufgebracht hat, testen. In den meisten Fällen machen wir CustomGPTs, dank unserem dritten Kollegen im KI-Team können wir auch eigene Bots bauen. Wenn die so entwickelten Tools gut funktionieren, stellen wir sie allen rund 380 Journalistinnen und Journalisten im Publishing zur Verfügung. So können wir mit wenig Ressourcen doch eine grosse Wirkung erzielen.
Was mir bei der Diskussion über KI wichtig ist: Man redet sehr viel über Technologie. Aber: Technologie ist immer nur ein Mittel zum Zweck. Immer.
Alexandra Stark
Alexandra Stark (55), ist Expertin KI bei CH Media. Sie hat nach dem Lehrerseminar Staatswissenschaften an der HSG studiert, die Ringier Journalistenschule absolviert und sieben Jahre lang als Korrespondentin in Moskau gearbeitet. Nach einem Master in New Media Journalism war sie bis 2024 Studienleiterin am MAZ. Jetzt arbeitet sie zur Hälfte für CH Media und zur Hälfte frei.