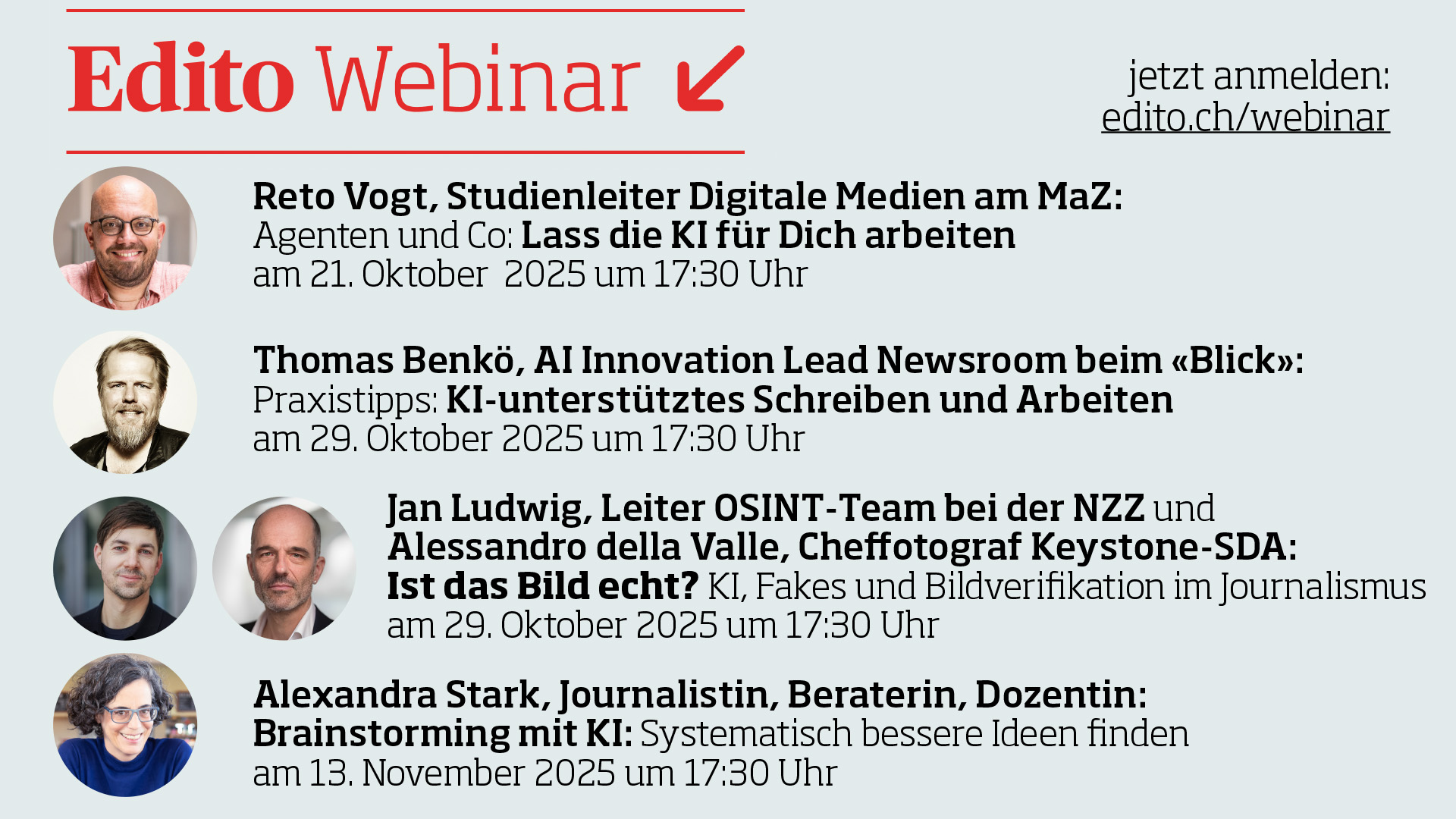Das Jahrbuch Qualität der Medien, die wichtigste Langzeit-Medienstudie der Schweiz, stellt der Schweiz kein gutes KI-Zeugnis aus: Zwar nutzen viele Medienschaffende KI-Tools, manchen sind die Rahmenbedingungen aber nicht klar. Auch in der Schweiz informieren sich immer mehr Menschen über Chatbots. Die KI-Firmen greifen für die Antworten auf die Inhalte von Schweizer Medien zurück, entschädigen sie aber nicht dafür. Gleichzeitig hat er die Zahl der Menschen, die gar keine Nachrichtenmedien mehr konsumieren, stark zugenommen. In seiner Studie hat das fög jetzt nachgewiesen, dass tiefer Medienkonsum mit weniger Wissen über die Welt verbunden ist.
Die Künstliche Intelligenz ist im Arbeitsalltag der Schweizer Medienschaffenden angekommen: Laut der Studie des fög nutzen 86,7 Prozent entsprechende Tools, fast die Hälfte davon stark oder sehr stark. Dabei greifen jüngere Medienschaffende und solche in grösseren Redaktionen häufiger auf KI zurück als ältere Personen und Mitarbeitende kleinerer Redaktionen. Besonders verbreitet ist der Einsatz für unterstützende Aufgaben wie Transkriptionen (49,3 %) oder Korrekturen (47,4 %). Bei der Produktion von Inhalten herrscht dagegen grosse Zurückhaltung: Nur KI-Vorschläge für Titel oder Leads sind relativ verbreitet (50,8 %).
Knapp zwei Drittel der Schweizer Journalist:innen beurteilen KI im Arbeitsalltag als nützlich. Ähnlich viele haben aber Vorbehalte bezüglich Qualität und Effizienz. 64 Prozent stellen fest, dass sich der Output von KI-Tools stetig verbessere, aber 69 wollen sich nicht auf den Output der KI-Tools verlassen. Nur etwa ein Drittel der Befragten gibt an, dass sich mit KI häufig die Qualität ihrer Beiträge steigern lasse. 15 Prozent haben schon Fehler in der Berichterstattung durch den Einsatz von KI erlebt.
Umso heikler ist es, dass 40 Prozent systematische Massnahmen zur Qualitätssicherung in ihrer Redaktion vermissen. 60 Prozent sagen zudem, die KI schaffe keine Freiräume für anspruchsvolle Tätigkeiten, sie hätten deswegen nicht mehr Zeit für wichtige und vernachlässigte Themen. Viele Medienschaffende sagen, dass sie nicht genügend Kapazitäten haben, um sich ausreichend mit der Funktionsweise von KI-Tools oder mit Daten- und Quellenschutz auseinanderzusetzen. Für viele Journalist:innen bleiben KI-Tools damit eine schwer durchschaubare «Black Box», die zudem auch noch grosse ethische Fragen aufwerfen.
Werbung
Für Medienkonsumenten spielen KI-Tools eine immer grössere Rolle. Bereits 18 Prozent der unter 25-Jährigen informieren sich über Chatbots über das aktuelle Geschehen. Das fög hat deshalb untersucht, woher die aktualitätsbezogenen Informationen der Chatbots stammen. Die Wissenschaftler haben Chatbots nach aktuellen Ereignissen und Nachrichten aus der Schweiz und dem Ausland befragt und untersucht, woher die KI ihre Informationen hat. Dabei hat sich gezeigt, dass bei Fragen zur Aktualität journalistische Medien der wichtigste Quellentyp für Chatbots sind. Zwar konsultieren Sie auch die Webseiten von Behörden, Parlamenten und Online-Lexika, aber journalistische Medien überwiegen im Verhältnis 3:1. Dabei zeigt sich, dass Medien wie Blick, Watson oder SRF, die Crawler nicht blockieren, häufig zitiert werden. Medien wie die NZZ, die KI ausschliessen, werden seltener, aber nicht nie zitiert. Wirklich zuverlässig sind die Chatbots dabei nicht. Jede zehnte Antwort enthielt teilweise oder vollständig falsche Angaben.
Die News-Deprivation – also die Unterversorgung mit Nachrichten – hat in der Schweiz weiter zugenommen. 2025 gehören bereits 46,4 Prozent der Bevölkerung zu den «News-Deprivierten». Damit ist ihr Anteil in den letzten 15 Jahren um 25 Prozentpunkte gestiegen. News Deprivierte sind Menschen, die keinerlei Nachrichten konsumieren oder sich nur über Social Media informieren. Das fög hat zum ersten Mal untersucht, welche Auswirkungen das auf das Wissen der Menschen hat. Die Resultate sind eindeutig: News-deprivierte sind über alle Bereiche hinweg die am schlechtesten informierte Gruppe. Menschen, die sich nur über Social Media informieren, weisen ein etwas höheres Wissen auf als Menschen, die gar keine Medien konsumieren. Aber auch sie liegen klar im Hintertreffen gegenüber anderen Nutzergruppen. Wir können wissenschaftlich fundiert daraus schliessen, dass Medienkonsum bildet.
Wie jedes Jahr hat das fög auch im Rahmen ihrer Langzeitanalyse die Qualität der Medien untersucht. Das Resultat zeigt ein gemischtes Bild: Die Medienqualität bleibt insgesamt stabil. Im längerfristigen Vergleich ist jedoch ein Rückgang bei Einordnung und Vielfalt zu beobachten. Interessant ist dabei die Beobachtung, dass die Auslandberichterstattung rückläufig ist. Aber auch die Konzentrationsprozesse in der Medienwirtschaft der Schweiz haben zu einem Verlust der Vielfalt geführt. In der Deutschschweiz ist im letzten Jahr jeder vierte redaktionelle Beitrag in mindestens zwei verschiedenen Medientiteln erschienen. Vor sieben Jahren waren es erst zehn Prozent. Treiber dieser Entwicklung sind die Verbundsysteme, also die Kopfblätter. Einen klaren Zusammenhang stellt das fög zwischen Qualität und Vertrauen fest. Medien mit hohen Qualitätswerten geniessen überdurchschnittliches Vertrauen, während qualitätsschwächere Titel geringe Vertrauenswerte erweisen.
Quelle: fög – Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft / Universität Zürich, Jahrbuch Qualität der Medien 2025.